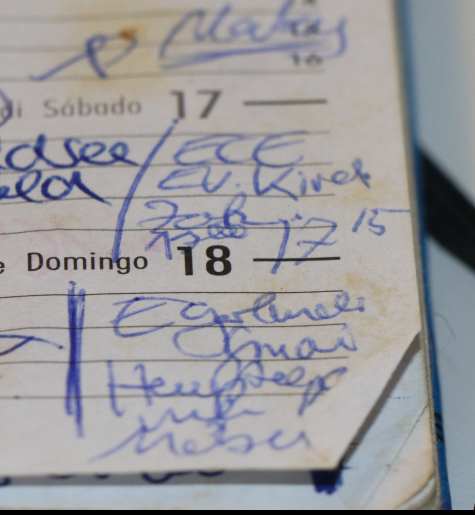
Ja, ich weiß, die Schrift!
Vor ein paar Tagen jährte sich bei mir unbemerkt der 13. Jahrestag meines ersten Zeitungsauftrags als freie Mitarbeiterin. Damals hatte ich – nach der Pflege meiner Mutter und einem Buchhaltungsjob in Heimarbeit – eine Alternative gesucht, als ich meine Mutter ins Pflegeheim bringen musste. Zwei Frauen, mit denen ich bekannt war, arbeiteten als Fotografin und Schreiberin für die Zeitung, für die ich seitdem arbeite, und meinten: Frag doch mal!
Ich fragte, ging vorbei und stellte mich vor. Man gab mir einen Stapel Ausgaben der Zeitung, damit ich mich in den gewünschten Stil einlesen konnte, ein paar Ratschläge – und die ersten Aufträge. Ausgerechnet Musik! „Davon verstehe ich aber nichts“, wandte ich ein. R., mein damaliger „Bezugsredakteur“, den ich im Laufe der Jahre sehr zu schätzen lernte, meinte nur: „Das macht nichts.“
Und so hatte ich als ersten Auftrag einen gesangsintensiven Lobpreisgottesdienst – bei dem sich zu meinem Nichtauskennen mit Musik auch noch eine nicht vorhandene Beziehung zur christlichen Frömmigkeit gesellte. Dann kam Volkstümliches: ein Fest einer Vertriebenengruppe, das Frühlingsfest der Trachtenkapelle, bei der auch mein Berliner Vater ehedem Musik gemacht hatte, ein Freiluft-Feuerabend… puh.
Nach ein paar Wochen fragte ich R., ob das, was ich liefere, okay sei. Er zögerte. „Das ist nicht okay, das ist gut“, meinte er dann. Ich schwoll an vor Stolz.
Und ich blieb bei dem hängen, was mal als vorübergehender Lückenfüller auf dem Weg zu einem „richtigen“ Job gedacht war. Schrieb mehr, machte irgendwann so viele Termine, dass ich abends erschöpft weinte – und reduzierte wieder, als mich ein Todesfall 2018 daran erinnerte, dass mein Leben endlich ist und ich mir einen Burnout als Freiberuflerin nicht leisten kann und will.
Nach ein paar Jahren begann ich auch zu fotografieren, legte mir eine Spiegelreflexkamera zu, später eine etwas größere. Mein Schwerpunkt verlagerte sich von Veranstaltungen zunehmend auf die Lokalpolitik – denn das will von freien Mitarbeitern kaum jemand gerne machen, und man muss auch ein bisschen ein Händchen dafür haben, inklusive eines Zugangs zu Behördendeutsch.
Inzwischen bin ich länger bei meinem Blatt als die meisten Redakteure dort. „Unter mir haben schon viele Chefredakteure gedient“, habe ich mal als Kommentar eines freien Mitarbeiters aufgeschnappt und mir gemerkt. Je länger ich diesen Job mache, desto leichter fällt er mir – denn ich kenne mich aus, kenne Ansprechpartner, weiß, bei wem eine Auskunft leicht zu erhalten ist und bei wem nicht.
Dieser Beruf hat mich sehr verändert. Ich war lange sehr introvertiert, schüchtern. Eine Rampensau werde ich wohl nie, und wenn ich irgendwo öffentlich sprechen muss, zittern mir noch heute die Hände. Aber in meiner kleinen Welt, diesem Tal hier, fühle ich mich sicher. Man kennt mich.
Inzwischen macht es mir Freude, mit Menschen zu reden, ihnen – wenn sie es zulassen – auf Augenhöhe zu begegnen. Denn mir liegt es nicht, einen devoten Kratzfuß zu machen, nur weil jemand einen Doktortitel hat (den habe ich selbst) oder ein bestimmtes Amt bekleidet. Genauso wenig schaue ich auf jemanden herab, der vielleicht keinen weiterführenden Schulabschluss hat oder keine korrekte Rechtschreibung beherrscht, sich aber als Vereinsvorsitzender oder Ortsvorsteher für etwas einsetzt. Ja, manchmal seufze auch ich im Geist über Kirchturmdenken und die persönlichen Eitelkeiten, die sich immer mal wieder Bahn brechen. Aber ich habe noch nie – wie es gerade manche studentische Kolleg:innen tun – auf einen Kleintierzuchtvereinsvorsitzenden oder eine Landfrauenvorsitzende herabgeblickt. Im Gegenteil: Auch und gerade mit denen hatte ich schon sehr interessante und lange Gespräche.
Natürlich bringt meine Arbeit auch einige Probleme mit sich. Da wäre zum einen das Geld – ich glaube, es war Der Spiegel, der mal einen Bericht über meinen Berufszweig mit „Arm, aber glücklich“ betitelte. Wobei ich schon darauf achte, dass ich mich nicht massiv unter Wert verkaufe, wie es manche Kolleginnen (nicht gegendert – das sind dann wirklich leider nur Frauen) tun.
Dazu kommen die gewöhnungsbedürftigen Arbeitszeiten, die mangelnde Absicherung bei Krankheit oder Jobverlust…
Ich will trotzdem zurzeit nichts anderes machen. Ja, ich liebe diesen Job – vor allem die Freiheit, dass ich selbst entscheide, was ich wann und wie arbeite.
Schreibe einen Kommentar