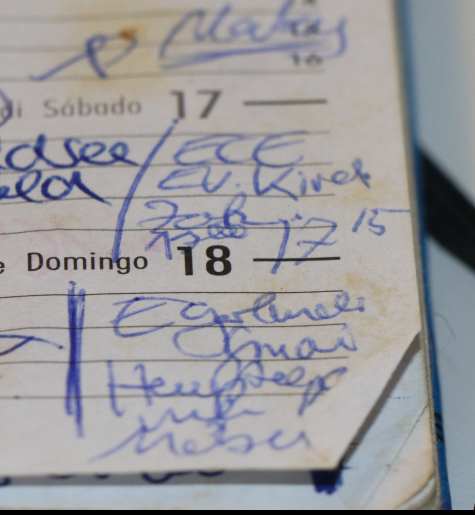Ich schreibe als Lokalreporterin natürlich auch über die Kerwe. „Was ist das, Kerwe?“, fragte mich vor kurzem eine Bekannte aus einem anderen Teil Deutschlands. Und ich versuchte zu erklären, wo zwischen kirchlichem Fest, teils skurrilem Brauchtum und allgemeinem, alkohollastigem Volksfest eine Kerwe angesiedelt ist. Für mich ist es ja imemr ein Spagat zwischen Heimatgefühlen und einem fremdelnden Blick darauf als „Zugereiste 2. Generation“.

Dabei sind diese Gewichtungen durchaus unterschiedlich. Eine relativ große Kerwe wie jene in Mörlenbach hat den Charakter eines Volksfestes – wir hatten dieses Jahr sogar ein Riesenrad! In kleinen Ortsteilen geht es dagegen oft intimer zu. Da ist dann zum Beispiel die Kerwepredigt wichtiger, bei der all jene aufs Korn genommen werden, denen im letzten Jahr ein blödes Missgeschick passiert ist. Diese Missgeschicke haben oft etwas mit Alkohol oder Traktoren zu tun und nicht selten mit beidem auf einmal. Sie werden vom Kerwepfarrer vorgetragen, dem ein Mundschenk immer wieder Getränke reicht. Üblich ist auch das Ausgraben und später das Vergraben der Kerwe am Anfang und Ende des Festes, in der Regel in Form einer Flasche.
Ich erzähle einfach mal, wie die Mörlenbacher Kerwe abläuft. Wie ich schon sagte, gehört sie zu den größten Festen hier im Weschnitztal. Jeder Ort hier hat sein „großes Fest“ – in Fürth ist es der Johannismarkt, in Rimbach der Pfingstmarkt, in Lindenfels das Burg- und Trachtenfest, und in Mörlenbach eben die Kerwe.
Kerwe bedeutet Kirchweih, weshalb sie der Weihe der Kirche durch den Bischof gedenkt. Im Katholischen wird auch gerne der Gedenktag des Heiligen gefeiert, dem die örtliche Kirche geweiht ist. Mancherorts sind das dann zwei Feste, in der Kerwe hier fließt das beides zusammen.
(Danke für den Hinweis Michael Bauer :-).)
(Und manchmal wurde sie auch aus logistischen Gründen verschoben, denn Kerwezeit ist fast immer im (Spät-)Sommer und Herbst, also nach der Getreideernte. Und es gibt auch Orte, die Kerwe feiern, ohne überhaupt eine Kirche zu haben.)
In Mörlenbach ist der heilige Bartholomäus der Patron, dessen Gedenktag am 24. August ist. Die Kerwe findet daher hier immer am letzten Augustwochenende statt und dauert vier Tage. Das Drumherum hat sich über die Jahre entwickelt und verändert sich auch weiterhin.
Los geht es am Freitagabend mit dem kleinen Umzug. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Landsknechte, die es seit 39 Jahren gibt. Ihre Mitglieder tragen bei Festen blau-gelbe Uniformen (bzw. Kleider bei den Landsknechtinnen – oder Landmägden?) und sind mit stumpfen Waffen und einer Kanone bewaffnet (in die sie dann Böller werfen). Sie gehören zum Heimat- und Kulturverein. Weswegen sie gegründet wurden, darüber könnte man wohl einen eigenen Beitrag schreiben.

Auf jeden Fall tragen sie den Kerwekranz beim kleinen Umzug, der der Eröffnung vorangeht. Der Kranz muss dann noch „geweiht“ werden (mit einer Gießkanne) und wird anschließend, während die Feuerwehrkapelle spielt, an einer Art Galgen über der Brücke aufgehängt, die zur Kerwezone führt. Dabei darf der „Kerwemarsch“ nicht fehlen, den es wohl vielerorts gibt.
Dessen denkwürdigen Text, der natürlich bei Ortsnamen und Dialektdetails variiert, habe ich neulich ergoogelt:
Refrain: Die (Dingsbumsbäscher) Kerb is do
was sin die Leit so froh es is e Reitschul do
Die (Dingsbumsbäscher) Kerb is do
was sin die Leit so froh heidi heido
Sie laafe nackisch uff de Stroos arum
un kaue Gerwinngumm un kaue Gerwinngumm
Sie laafe nackisch uff de Stroos arum
was sein die leit so dumm heidi heido
Geh hom un steck dei Hemm anoi
es kennt verisse soi es kennt verschisse soi
Geh hom un steck dei Hemm anoi
es kennt verisse soi verschisse soi
Dann geht es in den zentralen Bewirtungsbereich am Anfang der Kerwe. Während die Feuerwehrkapelle weiterspielt, stellen sich die Landsknechte auf der Bühne auf. Der Bürgermeister eröffnet dann mit einer Ansprache die Kerwe. Unser jetziger trägt dabei Odenwälder Tracht; der davor hatte eine Landsknechtuniform an, und bei dem davor … das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.

Dann kommt das Kerwepärchen zu Wort. Es rekrutiert sich in der Regel aus dem Umfeld der Landsknechte und trägt ebenfalls eine solche Uniform. In Mörlenbach halten sie eine kurze Rede im Dialekt, die aber nichts mit der oben erwähnten Predigt zu tun hat, sondern einfach nur auf das Fest einstimmt.

Natürlich darf wie bei so ziemlich jedem Fest der Fassbieranstich nicht fehlen. In Mörlenbach übernimmt das der Bürgermeister. Letzter Punkt der Eröffnungsfeierlichkeiten ist hier noch eine Show zu Beginn der Dunkelheit. Früher war es immer ein klassisches Feuerwerk, in den letzten Jahren wurde stattdessen mit einer Drohnenshow, einer Feuershow und dieses Jahr mit einem nachhaltigeren Feuerwerk experimentiert. Grund dafür ist nicht zuletzt, dass die Waldbrandgefahr in manchen Jahren doch recht hoch ist.

Danach wird gefeiert. Teenager besaufen sich und kiffen in versteckten Ecken der Kerwe, es gibt Musik, Schießbuden, Fahrgeschäfte – das ist wahrscheinlich überall gleich, ob Schützenfest oder Kirchweih.
Der nächste Höhepunkt ist der große Umzug am Kerwesonntag. Dazu ziehen alle möglichen Vereine, Mitglieder der politischen Gremien sowie Kindergruppen durch den Ort. Meist hat der Umzug ein Motto, an das sich die Teilnehmer mehr oder weniger mit Kostümen und Dekoration halten. Dazu kommen diverse Musikgruppen – entweder aus der Gemeinde selbst oder auch solche, die man dazubucht. In den letzten Jahren hat es sich eingebürgert, dass auch umliegende Kerwevereine oder Kerwejugenden mit einem Wagen dabei sind und dabei in der Regel mit viel Krach und Nebelmaschinen auf ihr Fest aufmerksam machen.






Am Montag geht es weiter mit einem Frühschoppen, es folgt noch Musik, und irgendwann ist die Kerwe dann vorbei. Mir fällt gerade auf, dass mir hier im Ort kein Kerwegottesdienst präsent ist, obwohl Mörlenbach traditionell recht katholisch ist.
So, jetzt wisst ihr Bescheid!